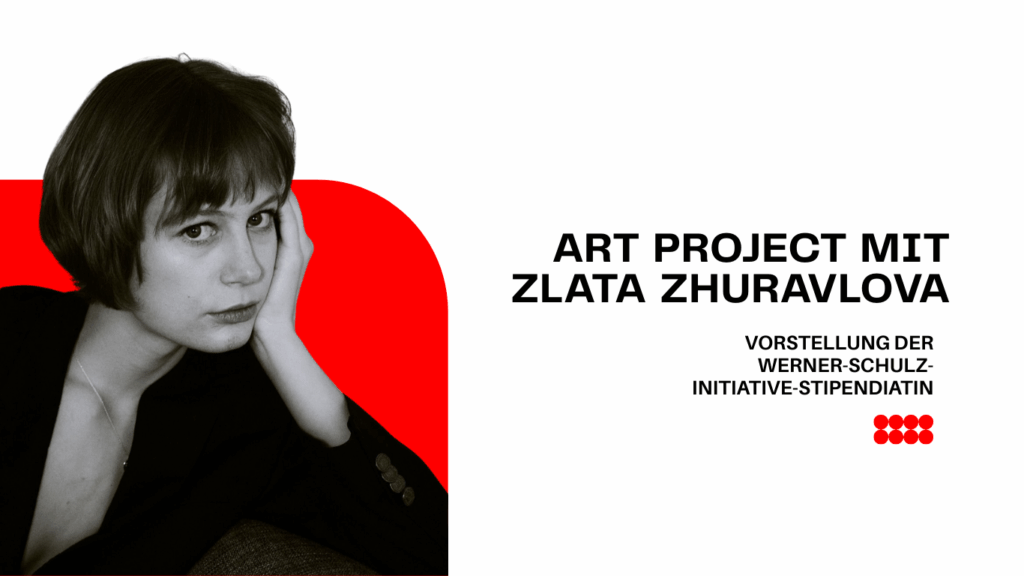„2020 war eine Explosion aufgestauter Wut“: Journalistin Glafira Zhuk über Proteste, Repression und die Zukunft von Belarus
Im August 2020 erlebte Belarus die größten Proteste in seiner Geschichte. Millionen Menschen gingen auf die Straßen, um ihren Unmut über gefälschte Wahlen und das jahrzehntelange autoritäre Regime von Aliaksandr Lukashenka auszudrücken. Die belarusische Journalistin Glafira Zhuk erklärt, warum gerade 2020 zum Wendepunkt wurde, wie die Proteste abliefen und wie die Zukunft von Belarus aussehen könnte.
— Wie hat sich die Protestbewegung in Belarus bis zu diesen Ereignissen entwickelt? Lukaschenkas Regime besteht doch schon seit mehr als 30 Jahren.
— Ich stieg erst 2020 ein. Ich war damals erst 19 Jahre alt und ziemlich jung. Aber natürlich gab es bereits zuvor Proteste in Belarus, seit 1994. In den 90er Jahren gab es bereits Massenproteste gegen die Machtkonzentration, vor allem nach dem Referendum in 1996. In den 2000er Jahren intensivierten sich die Proteste aufgrund des Verschwindens oppositioneller Politiker und brutaler Niederschläge. Jede Präsidentschaftswahl – 2001, 2006, 2010, 2015 – löste Wellen von Unmut aus. Die Menschen gingen nicht nur wegen Wahlfälschungen auf die Straße, sondern auch aus sozialen Gründen. Ein besonders deutliches Beispiel dafür waren die Proteste 2017 gegen die sogenannte „Parasiten-Steuer“. Die betraf Zehntausende.
Die Unzufriedenheit vor 2020 wurde auch durch die Covid-19 Pandemie verschärft. Die Regierung ignorierte COVID‑19: Lukaschenko leugnete öffentlich die Ernsthaftigkeit der Erkrankung und empfahl, sich mit dem Traktor behandeln zu lassen. Es gab keine Quarantäne-Gesetzgebungen und ließ die Bürger:innen mit dieser Situation völlig allein. Das stieß auf Empörung und Entsetzen – während die Gesellschaft sich selbst organisierte: Menschen sammelten Spenden für Ärzt:innen und halfen Krankenhäusern. Diese Solidarität bildete eine wichtige Basis für die Massenproteste im Sommer 2020. Was damals geschah, war kein spontaner Ausbruch, sondern der Höhepunkt eines langjährigen Kampfes und einer inneren gesellschaftlichen Bereitschaft zu Veränderungen.
— Warum wurde ausgerechnet 2020 zum Wendepunkt? Was löste diesen gewaltigen Ausbruch an Unmut aus?
— Viele Faktoren kam hier zusammen: Jahrzehnte lang angesammelte Unmut gegenüber dem Regime, groteske Wahlfälschungen, beispiellose Gewalt durch die Sicherheitskräfte und ein Vertrauensverlust in der Pandemiezeit. Die Menschen spürten: Es reicht. Sie gingen massenhaft auf die Straße.
— Wo waren Sie an den Wahltagen 9.–10. August? Was haben Sie gesehen?
— Ich war in der Stadt, mitten in Minsk. Ich sah mit eigenen Augen, wie friedliche Menschen auf die Straße gingen – und wie die Versammlungen brutal aufgelöst wurden. Es waren schreckliche Nächte, voller Gewalt durch die Einsatzkräfte – und voller Solidarität unter den Belarus:innen. Ich selbst verbrachte 30 Tage im Gefängnis Akrestsina, das für seine besonders brutale Behandlung von Gefangenen berüchtigt ist – in einer Zelle, die für zwei Personen ausgelegt war, aber mit 16 Frauen überfüllt war.

„Alle Sicherheitskräfte beschäftigten sich nur mit Repressionen“
— Was geschah nach der Niederschlagung der Proteste? Wie entwickelten sich die Repressionen?
— Die Repressionen dauern bis heute an – fünf Jahre lang. Ab 2021 lief eine regelrechte Repressionsmaschine an. Ein ehemaliger Sicherheitsbeamter berichtete mir später, dass alle Sicherheitsstrukturen ausschließlich politische Fälle bearbeiteten. Kriminalität, Drogenhandel, Mafia – trat in den Hintergrund. Priorität hatten nur noch „politische“ Fälle.
Politische Gefangene tauchten auf, verurteilt zu monströsen Haftstrafen. Unabhängige Medien wurden zerschlagen. Etwa 500.000 Belarus:innen verließen das Land – aber ich bin überzeugt, dass die Zahl höher ist. Dann begann der Krieg in der Ukraine, und selbst 2022 versuchten Menschen trotz Gefahr zu protestieren. Manche blockierten militärische Züge, die russisches Kriegsgerät transportieren. Dafür erhielten sie Haftstrafen von 15–20 Jahren.
Aktuell gibt es etwa 1.200 politische Gefangene in Belarus bei neun Millionen Einwohner:innen. Und das sind nur die Fälle, die bekannt sind. Zum Vergleich: In der UdSSR gab es 1989 etwa fünf politische Gefangene pro Million Bevölkerung – bei über 286 Millionen Menschen. Belarus liegt darüber.
„Lukaschenko entlässt einige – und verhaftet andere“
— Lukaschenko beginnt damit, politische Gefangene freizulassen. Ist das ein ehrlicher Schritt?
— Keineswegs. Meist werden Menschen aus sogenannten „humanitären Listen“ begnadigt. Das sind Schwerkranke, solche mit einer Reststrafe oder EU‑/US‑Staatsbürger:innen. Es ist reine PR: „Seht her, ich lasse frei.“ Aber er entlässt zehn und verhaftet am nächsten Tag fünfzehn andere. Die Repressionen hören nicht auf und es ist wichtig, weiterhin darüber zu sprechen.
— Stimmt es, dass derzeit Kommissionen eingerichtet werden, die angeblich Emigrant:innen die Rückkehr ermöglichen?
— Ja, so eine Kommission existiert wirklich – vom Regime installiert. Man schreibt einen Bußbrief und kann angeblich sicher zurückkehren. Aber es gibt keine Garantie, nicht verhaftet zu werden.
„Man wird wegen Likes und Reposts verurteilt“
— Angenommen, jemand hat an Protesten teilgenommen und möchte zurückkehren. Kann er sicher sein, dass ihm nichts passiert?
— Niemand kann das wissen. In Belarus kann man heute für einen Like, Kommentar oder Repost eines unabhängigen Mediums verurteilt werden. Diese gelten als extremistisch. An der Grenze wird bei der Einreise das Telefon durchsucht, Social‑Media-Konten geprüft und man wird ausgefragt.
— Und was ist mit im Ausland lebenden Belarus:innen? Funktionieren die Konsulate?
— Ende 2023 erließ Lukaschenko ein Dekret, wonach die konsularischen Vertretungen keine grundlegenden Funktionen mehr ausüben dürfen – keine Passausstellungen, Verlängerungen, Zertifikate, Vollmachten. Das geht nur noch persönlich in Belarus. Wer einen auslaufenden Pass hat, steht in der Luft. Einige sind seitdem zurückgefahren, um Dokumente zu holen – und wurden dann vor Ort verhaftet. Viele leben daher inzwischen ohne gültige Papiere. Einige beantragen spezielle Reisedokumente, also vorübergehende Ausweise, die in der EU gelten. Andere versuchen, Asyl zu erhalten – das ist aber langwierig und schwierig. Es gab die Idee eines „Neuen‑Belarus‑Passes.“ Das Produkt existiert zwar bereits, aber seine Anerkennung durch andere Staaten bleibt unklar.
„Ich stehe im zwischenstaatlichen Fahndungsregister“
— Häufig wird ein Strafregisterauszug verlangt. Aber viele belarusische Geflüchtete haben politische Urteile vermerkt.
— Ja, das ist ein Problem. Aber mit der Zeit haben viele Organisationen, die solche Auszüge verlangen, Verständnis entwickelt und bestehen nicht mehr darauf.
— Sie erwähnten, dass Sie auf einer internationalen Fahndungsliste stehen?
— Ja. 2024 wurde ein Strafverfahren gegen mich eröffnet. Ich weiß nicht wegen welcher Tat. Dieses Jahr wurde ich ins internationale Fahndungsregister eingetragen. Ich kann nicht in Länder reisen, mit denen Belarus Auslieferungsabkommen hat.
„Lukaschenko ist Putins Vasall“
— Einige Oppositionsakteur:innen bezeichnen Belarus als von Russland besetzt. Wie sehen Sie diese Einschätzung?
— Juristisch ist Belarus nicht besetzt. Es fehlen dafür international anerkannte Zeichen militärischer Besatzung wie auf der Krim oder im Donbas. Aber faktisch hängt das Regime stark vom Kreml ab – in wirtschaftlicher, politischer, medialer und militärischer Hinsicht. Seit den Protesten 2020 und besonders seit dem Krieg 2022 ist Lukaschenko de facto Putins Vasall. Der Begriff „Besatzung“ dient eher als politische Metapher – er drückt das Gefühl einer fremdbestimmten Kontrolle aus.
— Besteht die Gefahr, dass Belarus als Sprungbrett für einen Angriff auf die baltischen Staaten genutzt wird?
— Theoretisch ja – viele befürchten das. Aber ich glaube nicht, dass Putin es riskiert, bei einem bereits offenen Krieg in der Ukraine. Die Baltischen Staaten stärken richtigerweise ihre Grenzen. Denn niemand hatte 2022 eine russische Vollinvasion in die Ukraine erwartet. Persönlich halte ich ein solches Szenario derzeit für unwahrscheinlich.
— Wie beurteilen Sie die Unterstützung für Lukaschenko in Belarus selbst?
— Unabhängige Umfragen gibt es nicht. Aber wir wissen über aktive Partisan:innenbewegungen, unabhängige Medien und Kommunikation „über fünfte Hände“: Alles, was wir 2020 erlebt haben: Großkundgebungen, alternative Wahlen, Streiks und Proteste selbst in kleinen Städten. Das zeigt, dass ein bedeutender Teil der Gesellschaft dieses Regime nicht unterstützt. Seit 2020 bleibt Lukaschenko dank Repression, Propaganda und Unterstützung durch den Kreml an der Macht – nicht durch Legitimität.
— Wie funktioniert die belarusische unabhängige Journalistik jetzt?
— Wir leben alle im Exil – in Polen, Litauen und anderen Ländern. 38 unserer Kolleg:innen sitzen im Gefängnis und verbüßen teils grausame Strafen. Viele haben den Beruf aufgrund von Verfolgung und dauerhaftem Druck aufgeben müssen. Ich selbst war 30 Tage im Okrestina-Gefängnis inhaftiert, das für seine besonders harte Behandlung von Gefangenen bekannt ist. Die Zelle, in der ich untergebracht war, war für zwei Personen ausgelegt. Tatsächlich befanden sich dort 16 Frauen. Trotz alledem versuchen wir weiterhin, die Menschen im Land zu erreichen. Viele Medienprojekte haben nach Entscheidungen unter der Trump-Regierung bis zu 50 % ihrer Fördermittel verloren. In diesem Kontext ist es entscheidend, den unabhängigen Mediensektor im Exil zu erhalten – er ist ein eigenes Ökosystem und ein Hebel der Einflussnahme für diejenigen, die noch im Land sind.
„Belarus’ Zukunft hängt vom Ausgang des Kriegs in der Ukraine ab“
— Wie sehen Sie die Zukunft von Belarus? Ist ein demokratischer Übergang möglich, wenn Lukaschenko geht?
— Heute lässt sich über Belarus’ Zukunft nicht getrennt von den Entwicklungen in der Ukraine sprechen. Ein ukrainischer Sieg ist ein Schlüssel für die Ukraine selbst – aber auch für Belarus und die gesamte Region. Das Lukaschenko‑Regime existiert ausschließlich dank Putins Unterstützung – finanziell, militärisch und politisch. Ohne ihn wäre es nicht lebensfähig. Der Sturz des russischen Regimes könnte auch in Belarus Veränderungen auslösen.
Internationale Druckmaßnahmen dürfen nicht nachlassen – vor allem Sanktionen. Das ist eines der wenigen friedlichen Instrumente, das das Regime in Ressourcen und Isolation wirklich trifft. Ich verstehe, dass es unterschiedliche Positionen gibt: Manche sagen, man solle nun den Dialog mit Lukaschenko suchen, um politische Gefangene freizubekommen. Aber das Problem bleibt: Er entlässt einige, verhaftet wieder andere. Die Repression ist nicht gestoppt. Unser Ziel bleibt: die völlige Einstellung der Repression, die Freilassung aller politischen Gefangenen und ein demokratischer Wandel.
Das Gespräch wurde aufgezeichnet von: Mariia Kutnyakova
Fünf Jahre nach den gefälschten Präsidentschaftswahlen in Belarus bleibt die Demokratiebewegung lebendig – auch wenn sie zunehmend aus dem Blickfeld der Weltöffentlichkeit gerät. Austausch e.V. unterstützt weiterhin das belarusische Volk im Kampf für Demokratie und Menschenrechte.
Mit großer Besorgnis sehen wir, dass die Bundesregierung seit Mitte Ende Juli 2025 sämtliche humanitären Aufnahmeverfahren ausgesetzt hat – darunter auch Einzelaufnahmeprogramme nach § 22 Satz 2 Aufenthaltsgesetz, die politisch verfolgten Menschen aus Belarus, Russland und weiteren autoritären Staaten Schutz ermöglichen sollten.
Derzeit werden keine neuen Programme aufgelegt und keine entsprechenden Visa erteilt. Zudem bleiben selbst Fälle ohne bereits erteilten Aufenthaltstitel unberücksichtigt. Für viele akut gefährdete Menschen entfällt damit eine zentrale legale Zugangsoption nach Deutschland – unabhängig vom regulären Asylverfahren.
Wir fordern die Bundesregierung auf, diese Entscheidung zu überdenken: Politisch verfolgte Demokratieaktivist:innen brauchen legale, sichere Wege. Ihre Aufnahme stärkt nicht nur die belarusische Opposition sowie andere Demokratiebewegungen im Exil, sondern stärkt auch demokratische Werte in Deutschland und Europa.
Жыве Беларусь! (Lang lebe Belarus!)