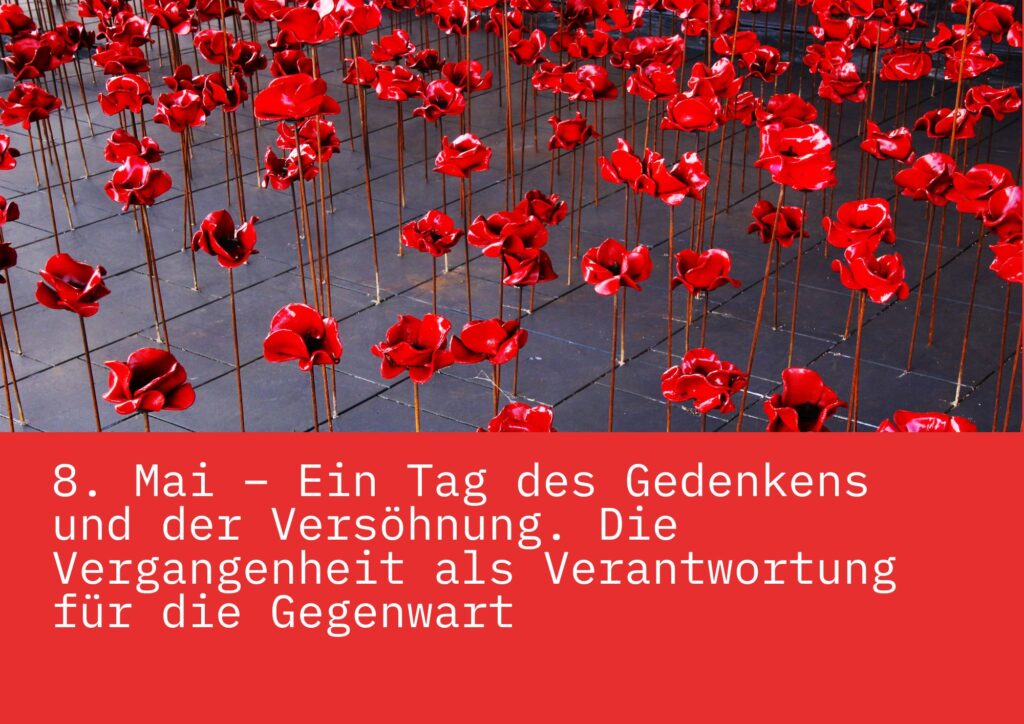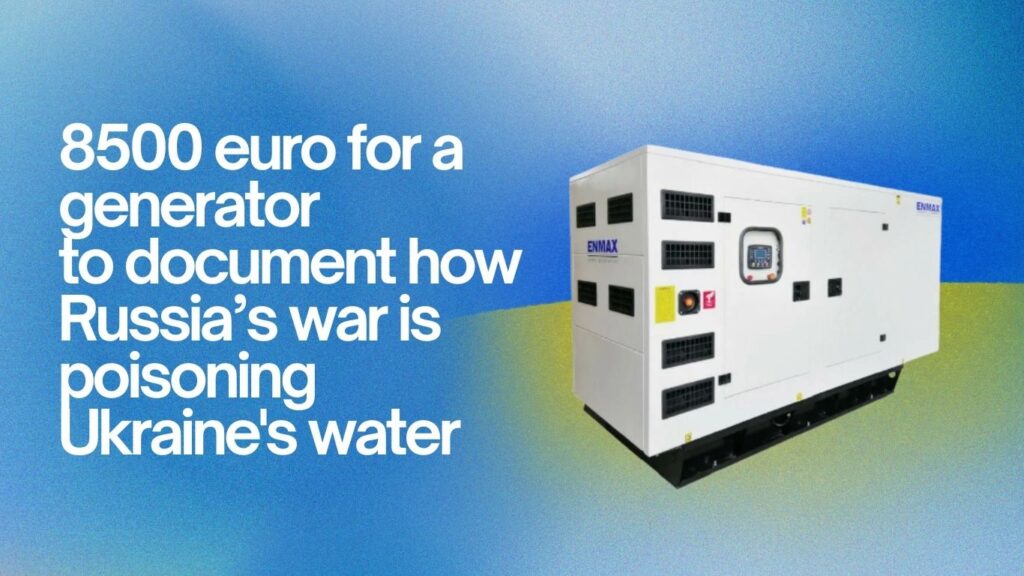8 Mai – Ein Tag des Gedenkens und der Versöhnung. Die Vergangenheit als Verantwortung für die Gegenwart
Am 8. Mai 2025 gedenken wir des Endes des Zweiten Weltkriegs – eines Wendepunkts, der Europa und die Welt neu gestaltete. Der Sieg über das nationalsozialistische Deutschland, in Deutschland als Tag der Befreiung erinnert, sollte den Beginn einer neuen Ära des Friedens, der Zusammenarbeit und gemeinsamer Werte in Europa und darüber hinaus markieren. Doch heute erleben wir, wie die Prinzipien, die das Fundament des Nachkriegseuropas bildeten, erneut angegriffen und täglich herausgefordert werden.
Russlands umfassender Krieg gegen die Ukraine ist nicht nur ein Fall militärischer Aggression; er ist auch ein Angriff auf die Werte von Freiheit, Demokratie, europäischer Solidarität und historischer Verantwortung. Er untergräbt die zentrale Lehre des Zweiten Weltkriegs: dass staatliche Gewalt und territoriale Eroberung niemals wieder als legitim akzeptiert werden dürfen. Gleichzeitig erleben wir einen besorgniserregenden Anstieg von rechtsextremem Extremismus und autoritären Tendenzen in Europa und weltweit – eine Entwicklung, die uns dazu drängt, über die Vergangenheit nachzudenken und unser Engagement für den Schutz demokratischer Werte, die Verteidigung der Menschenrechte und die Rechtsstaatlichkeit zu erneuern.
Deshalb haben wir unsere Partner und Experten, die sich in der politischen Bildung und Erinnerungsarbeit engagieren – insbesondere durch unsere Projekte „Lost in Transition?“ und „Transition Dialogue“ – gefragt, wie sie die Bedeutung des 8. Mai im Lichte der heutigen dringenden Herausforderungen, ihrer historischen Erfahrungen der letzten 80 Jahre und der gesellschaftlichen und politischen Realitäten, denen wir heute gegenüberstehen, verstehen.
Olena Pravylo, ukrainische Kultur- und zivilgesellschaftliche Aktivistin:
„Leider können wir noch nicht von einem wirklich gemeinsamen europäischen Verständnis der Folgen des Zweiten Weltkriegs sprechen. Während ‚Nie wieder‘ ein gängiger Ausdruck ist, variiert seine Bedeutung erheblich. Für Ukrainer waren die sowjetischen ‚Befreier‘ auch Kolonisatoren. Das erschwert ein einheitliches europäisches Gedächtnis. In der Ukraine geht es bei der Erinnerung nicht mehr nur um die Vergangenheit – es geht ums Überleben. Der 8. Mai, einst vom sowjetischen 9. Mai überschattet, gewinnt als Tag der Reflexion statt militarisiertem Triumph an Bedeutung. Wir überdenken Denkmäler, schreiben Lehrpläne um und gestalten sogar unsere Sprache mit einer dekolonialen Perspektive neu. Heute ist die Ukraine ein lebendiges Zeugnis für die Gefahr, imperiale Ambitionen zu ignorieren. Erinnerung ohne Verantwortung ist gefährlich. Europa muss handeln – nicht nur sprechen –, um Gerechtigkeit, Demokratie und Würde zu schützen. Wir brauchen Solidarität nicht nur in Erklärungen, sondern in Systemen, die den Frieden wirklich verteidigen.“
Aliaksei Lastouski, Akademischer Direktor, Belarussisches Institut für öffentliche Geschichte:
„Der Konsens über die Ergebnisse des Zweiten Weltkriegs hatte zwei Seiten: erstens die Anerkennung des Nationalsozialismus als das ultimative Übel. Zweitens die Bildung einer Gemeinschaft der Sieger, die für die Schaffung einer neuen Weltordnung verantwortlich ist. Heute zerfällt diese Gemeinschaft rapide aufgrund des von Russland entfesselten aggressiven Krieges. Die Strategie, Russland und Belarus zu isolieren – sie aus der Gemeinschaft der Erben des Sieges über den Nationalsozialismus auszuschließen – gewinnt an Dynamik. In Belarus wurde die Kriegserinnerung vom Regime instrumentalisiert: Politische Gegner werden als Erben nationalsozialistischer Kollaborateure bezeichnet, und ein Gesetz über den Völkermord am belarussischen Volk während des Zweiten Weltkriegs wird für innenpolitische Zwecke genutzt. Gleichzeitig bringt die belarussische Zivilgesellschaft das Thema Dekolonisierung zur Sprache, aber Repression und Exil behindern diesen Prozess. Bitte denken Sie daran: Die belarussische Gesellschaft ist nicht dasselbe wie das belarussische Regime. Und denken Sie auch daran, dass Belarus im Epizentrum der ‚Blutländer‘ stand – wo der Holocaust und Massenvergeltungsaktionen stattfanden. Ohne dieses tragische Erlebnis zu verstehen, können wir die volle Brutalität des Zweiten Weltkriegs nicht begreifen.“
Sandra Gaučiūtė, Offene Litauen-Stiftung:
„Ein gemeinsames europäisches Gedächtnis des Zweiten Weltkriegs wird noch immer geformt – und viel zu langsam. Russlands Aggression erinnert uns daran, dass die Lehren der Geschichte nicht vollständig gelernt wurden. In ganz Europa kehrt totalitäres Denken zurück: Die Zivilgesellschaft steht unter Druck, die Presse ist geschwächt, und historische Fakten werden durch Nostalgie und Verschwörung ersetzt. In Litauen wissen wir, dass der Zweite Weltkrieg 1945 nicht endete. Es folgten Jahrzehnte sowjetischer Besatzung, die in weiten Teilen Westeuropas noch immer schlecht verstanden werden. Deshalb unterstützen wir die Ukraine so stark: Wir sehen uns in ihrem Kampf. Der 8. Mai ist mehr als ein Gedenken geworden – er ist eine wertebasierte Haltung, eine moralische Verpflichtung zum Handeln.“
Lusine Kharatyan, armenische Schriftstellerin und Anthropologin:
„Während es in der Ukraine Initiativen gibt, den 9. Mai als Europatag zu feiern (weitgehend definiert durch die Schuman-Erklärung und verbunden mit ‚Frieden und Einheit in Europa‘) und somit die symbolische Bedeutung des 9. Mai in den postsowjetischen Ländern (Tag des Sieges, der den Sieg der Sowjetunion über das nationalsozialistische Deutschland gedenkt) neu zu interpretieren und zu überarbeiten, wird er in vielen postsowjetischen Ländern, insbesondere in Russland, immer noch als Tag des Sieges wahrgenommen. In Russland ist dies eine große Demonstration der Macht des Landes, mit einer Militärparade und begleitenden Veranstaltungen. In Armenien wurde der 9. Mai seit dem Ende des ersten Artsakh/Karabach-Krieges (1994) als ‚dreifacher Feiertag‘ wahrgenommen und bezeichnet, der den sowjetischen Sieg im Zweiten Weltkrieg und die Befreiung von Shushi (einer Stadt in Artsakh/Karabach) feierte, was symbolisch das Ende des Krieges markierte. Es wurde als ‚Tag des Sieges und des Friedens‘ gefeiert. Der Krieg in der Ukraine hat die Neuinterpretation des Gedenkens nicht so stark beeinflusst wie der Artsakh-Krieg und dessen Folgen nach dem Krieg 2020 und der ethnischen Säuberung der Armenier. Diese Ereignisse führten zur Neuinterpretation nicht nur des 9. Mai (seiner Verbindung zum Sieg im ersten Artsakh/Karabach-Krieg), sondern auch der Beziehungen zwischen Armenien und Russland, was zur Entstehung stärkerer dekolonialer Stimmen/Narrative führte.“
Diese Reflexion ist nur ein Teil eines breiteren Dialogs über Erinnerung, Verantwortung und die Bedrohungen, denen wir heute gegenüberstehen. Wenn wir uns am 8. Mai erinnern, ehren wir nicht nur die Opfer. Wir sind aufgerufen, Aggression, Revisionismus und die Instrumentalisierung der Geschichte zu widerstehen.
Erinnerung ist nicht nur Gedenken. Sie ist ein Aufruf zum Handeln.